|
|
|
Die Monkey Wrench Gang – ein ökoterroristisches Abenteuer “Ich höre den Ruf des Flusses.” “Das ist die Toilette”, sagte sie. “Das Ventil hat
sich schon wieder verklemmt.” So leicht kann man sich in fundamentalen Dingen
irren, wo wir ohnehin schon immer glaubten, dass hier die fatalen Irrtümer
am leichtesten fallen. Das „Zurück zur Natur“ versank seit je im
holistischen Kitsch, der auch dieser Tage kein geringer Motor für
politisch wohlfeile Überzeugungen und blütenweiche Geschäftemacher ist.
Wir ergehen uns gerne in den Wohligkeiten eines künftigen Ökoparadieses,
das neben den unzähligen anderen Paradiesen liegt, dem
Urkommunismusparadies, dem utopischen Konfliktabschaffungsparadies, den im
Kerker projizierten Sonnenstaaten und Phalanstères, die der Gewächshausfanatiker
Charles Fourier vergeblich propagierte.
„Die Monkey Wrench Gang“ von Edward Abbey
nimmt uns in eine Natur mit, ohne den ambivalenten Sinn für Zivilisation
und Technik an der Eintrittskasse des Nationalparks abzugeben zu müssen.
Hier wird grün bis giftgrün das projiziert, was den meisten nicht
gegeben ist, nämlich Abenteuer, Moral und Maschinensturm in saftiger
Liebe zur Natur zu leben und doch die neben Läusen juckenden Paradoxien
der Zivilisation zu spüren. Edward Abbey sammelte zuvor in der US-Armee
einschlägige Erfahrungen, davon zwei Jahre als Militärpolizist, später
war er Saison-Ranger und Feuerwache in Nationalparks – was seine
martialischen Waldläufer so plausibel macht wie die kundigen Bewegungen
durch die Natur. „Monkey wrench“ bezeichnet einen gewöhnlichen
Universalschraubenschlüssel, metaphorisch geht es weiter reichend um den
anarchischen Zugriff auf alle Apparatur, die uns den Weg (zurück) zur
Natur verbaut. Die Moral unserer Ökohelden fordert kategorisch kreatives
Chaos, jenen Sand im Getriebe, der sich als neuer Baustoff für bessere
Gesellschaften anempfiehlt. „Monkeywrenching“ wurde zum anregenden
Terminus technicus des Widerstands, der sich „marcusianisch“ gegen
unnatürliche Sachen, nie gegen Menschen, richtet. Die Freuden der Explosivliteratur Noch heute behaupten Rezensenten dieses 1975 in
politisch umtriebiger Zeit veröffentlichen Romans, mit dem Edward Abbey
seinen Ruhm begründete, dass nach dessen Lektüre den Leser eine
unstillbare öko-logische Zerstörungslust durchzittere, wenn er
technisches Gerät vor Augen hat. Nun kann das auch auf Lektüreschwäche
zurückzuführen sein wie jenes antihermeneutische Gefühl, von dem
Theodor W. Adorno sprach, wenn der Kinobesucher nach Filmende seinen
Mantelkragen bogartesk hochklappt und für fünf Minuten gefährlich wird,
bis er wieder seiner kleinbürgerlichen Existenz anheim fällt. Zuviel
Medienkompetenz stört die Empathie. Abbey spart nicht mit Anlässen für
Empathie. Die Helden treffen sich über der Idee, den „Glen Canyon
Damm“ zu zerstören, der rücksichtslos die wilde Natur unkenntlich
gemacht hat. Es sind unübliche Verdächtige: „Doc Sarvis“ ist ein
erfahrener Arzt, der schon mal Staatsanwälte medi-zynisch leiden lässt.
Des Nachts leistet er als Adbuster bzw. kommunaler Feuerteufel der
Reklametafeln den Notdienst der etwas anderen Art. Nachtaktiv wird er
immer in Begleitung seiner kiffenden Geliebten und Assistentin Bonnie
Abbzug, die alles andere als eine amouröse Randfigur der ökoterroristischen
Rückeroberung der freien Natur sein will, sondern selbst um ihren Platz
am Abzug kämpft. Mit von der Partie ist der Polygamist und „Jack-Mormon“
Seldom Seen Smith, der viel von der Destruktion destruktiver Technik
versteht, aber auch schon mal eine Wunde nähen kann, wenn Not am Mann
ist. George Washington Hayduke ist ein sensibles Erdferkel, eben ein
Heiducke oder „Hayduke“ (Freiheitskämpfer), ständig Bier schlürfend,
pyromanisch, ein Green Beret mit moderatem Vietnam-Trauma, der
martialischer als seine Freunde agieren würde, wenn da nicht das
verdammte Einheitsprinzip der Abstimmung der Aktionen wäre – und, das
muss jetzt „raus“, er noch nie jemanden getötet hat. Nach dem
vietnamesischen Weltrettungsdesaster gilt jetzt: „Mein Job ist es, die
verdammte Wildnis zu retten. Ich wüsste nicht, was es sonst zu retten gäbe.“
Als Natur- aber eben auch Waffenfreak scheint er unmittelbar einem
rebellischen U-Comix entsprungen zu sein. Im Grunde aber ist die Gang eine
multiple Persönlichkeit der Öko-Resistance, die in vier Figuren
gespalten ist, ohne deren psychologisches Profil und kommunikative Dynamik
allzu weit zu entwickeln. Unsere Sympathie wandert über Abbeys Figuren,
gehört aber mehr der Anarcho-Gang als irrwitziger Ökokraft und ihrem Tun
und weniger den Charakterskizzen. Abbeys Naturbeschreibungen sind
mindestens ebenso wichtige Gravitationsfelder des Werks und nie bloße
Kontexte für Figuren und Szenen. Das gerät ihm indes nicht zur
bierernsten „ecodefense“, sondern er persifliert die reine Devotion
gegenüber der heiligen oder vorgeblich unschuldigen Natur. „Keine
Szenesprache, wenn ich bitten darf. Dies ist ein heiliger Ort. Schon gut,
aber wo steht der Cola-Automat?“ Jean Starobinski hat hierin Rousseaus
ungelöstes Dilemma erkannt, nämlich die Spannung zwischen dem abstrakten
Begriff von Natur und Tugend, der sich nicht mit der empirischen Natur des
eigenen chaotischen Selbst zu einer unschuldigen Einheit verbindet. Wenn
es kein „Zurück“ zu dieser vermeintlichen Natur des ersten Menschen
gibt, gilt eine andere Natur, die uns versichert, dass es widernatürlich
wäre, an heiligen Orten nicht auch an Cola denken zu dürfen. Bei Abbey
liegen derlei zen-buddhistisch bis psychedelisch zeitgeistige
Erleuchtungen zwischen Huineng, Thomas Merton oder Carlos Castaneda wie
schwerelos machender Blütenstaub ständig in der Luft. Doc wird von
Ameisen angegriffen und zertritt einen Ameisenhaufen. So widerlege er
Buckminster Fuller, Walter Gropius et alii. Eine zertretene Bildröhre
widerlegt Marshall McLuhan. Tritte sind ein altes Thema praktischer
Philosophie, wie wir seit Samuel Johnson wissen, der so Bischof Berkeleys
subjektiven Idealismus widerlegen wollte, indem er kräftig gegen einen
Stein trat. Der Bilderstürmer Bonifatius beginnt die biopraktische
Heidenbekehrung mit dem Fällen der heiligen Donar-Eiche. Das war religiöser
und ökologischer Frevel, soll aber wegen der damaligen Machtverhältnisses
kein großes Risikogeschäft gewesen. Walt
Whitmans Motto „Resist much. Obey
little“ leitet das Werk ein und Abbey hat diesen Leitspruch später als
Scheinparadox formuliert: „A
patriot must always be ready to defend his country against his government.”
Schon Henry David Thoreau verband „die Pflicht zum Ungehorsam
gegen den Staat" mit dem Zurück zur Natur: „Das Gesetz hat die
Menschen nicht um ein Jota gerechter gemacht; gerade durch ihren Respekt
vor ihm werden auch die Wohlgesinnten jeden Tag zu Handlangern des
Unrechts." Abbey variiert dieses Motiv, wenn etwa die Gang die
„dreckigsten Ausdrücke“ der Energieherrscher als Ehrentitel ansieht
oder der Knast zur Auszeichnung wird. Ökoaktivismus heißt mehr als ein
gewandeltes Naturverständnis, es geht nicht ohne die fundamentale
Umwertung der politischen Werte.
Logisch? Ökologisch! Soviel steht fest: Maschinen zu zerstören, die
die Erde malträtieren, macht Spaß. Aber warum tut man das eigentlich?
Abbey ist vorsichtig und zu reflektiert, um sich auf vorschnelle
Festlegungen der Motivation seiner Helden einzulassen, um in die Falle des
eindimensionalen Ökoschützers zu tappen. Den Gangmitgliedern ist ihr
Motivationsmix längst nicht so klar, so sicher sie alle wissen, dass sie
es tun müssen. Sorgen um die Natur, Wut auf die fiesen Kapitalisten, Lüste
auf Widerstand, Kampf gegen die Obrigkeit und natürliche Sinnlichkeit
mischen sich zu einem anarcho-syndikalistischen Cocktail, der wie jeder
gute Cocktail einen Hang zum Explosiven besitzt. Wie gut, dass
literarische Explosionen wie dieser „Tequila Canyon Sunrise“ so gut überstanden
werden, was seinerzeit Roland Barthes auch den de Sade´schen Blutorgien
bescheinigte, die eben bei aller Mordlust Literatur und kein Fleisch
seien. Das als Packungsbeilage für den Staatsanwalt! Ein kongenialerer Illustrator für dieses
Projekt als Robert Crumb wäre wohl kaum zu finden gewesen, denn seine
Figuren schütten des Lesers Projektionswelten nicht zu, sondern umspielen
unsere Fantasie, wie denn solche verrückten Helden wohl aussehen könnten
- zumal wir es ja insgeheim selbst sind. Wer es weniger aufwendig und gefährlich
liebt, darf sich zunächst den politisch unkorrekten „The Animated Monkeywrench Cursor“ http://www.abbeyweb.net/cursor.html)
statt der allfälligen Microsoft-Icons herunterladen. So wie weiland
bereits der gelbrote Anti-AKW-Aufkleber die halbe Miete des zivilen
Widerstands war und uns so solidarisch mit der unverstrahlten Zukunft
machte. Den Widerwillen gegen diese und andere Zivilisationen, der
weit über ein bloßes Unbehagen an der Kultur hinausgeht, werden wir nie
verlieren. Keiner unter uns, der nicht ab und an von der tiefsten Lust
erfasst würde, den ganzen Zivilisationsfrust in purer Gewalt gegen den
wuchernden Techno-Schrott und die Unsäglichkeiten einer bürokratisierten
Existenz zu entladen. Diese klammheimliche bis geständige
Destruktionslust vergeht indes oft so schnell wie sie kommt, wenn wir am
Computer von serviler Technik beschwichtigt werden. Diese heterogenen
Wirkungen begründen für das Mängelwesen „Mensch“ ein ambivalentes
Gefühl, das der ohnehin ramponierten „conditio humana“ weiteres
Kopfzerbrechen bereitet. „Gegenüber den Großaffen, die
hochspezialisierte Baumtiere mit überentwickelten Armen für
Hangelkletterei sind, die Kletterfuß, Haarkleid und gewaltigen Eckzahn
haben, ist der Mensch als Naturwesen gesehen hoffnungslos unangepasst“,
schrieb Arnold Gehlen. Monkey Gang-Mitglied George Washington Hayduke
kompensiert sein Mängeldasein mit einer Unmenge von martialischem
Equipment, als würde jede Kampfsituation ihr je spezifisches Instrument
benötigen. Aber die Faszination für gadgets beschränkt sich nicht auf
vordergründige Fronten von guter und böser Technik, also den „dual use“.
Auch die Instrumente des Gegners, die zerstört werden müssen, die
gewaltigen Landmaschinen und künstlichen Kraftwesen, sind faszinierende
Gegenstände. Edward Abbey formuliert diese lustvollen Antagonismen einer
hypertrophen Maschinenwelt erstaunlich genau. Allein das macht dieses Werk
– um im Thema zu bleiben – immergrün: Es ist die Spannung zwischen
der coolen Maschinenmacht imperialer Unternehmen und der Natur im Verbund
mit ihren Öko-Kriegern, die eben nicht entlang einer simple Frontlinie
verläuft. Edward Abbey lässt seine Protagonisten die Macht und Ästhetik
des technischen Geräts bewundern, das den überlieferten Begriff der
Natur selbst auflöst. Paradigmatisch ist dieser Satz, in dem sich die
Liebe zum Kreatürlichen von der alten Unterscheidung von Natürlichkeit
und Künstlichkeit befreit: „...Der Todeskampf der Zylinderringe, von
geschwollenen Kolben eingequetscht, ist vielleicht – wie andere Formen
der Sodomie auch – in den Augen des Deus ex Machina ein Verbrechen wider
die Natur; wer vermag das schon zu sagen?“ Eine zerstörte Karosserie
erscheint dann wie ein „zerquetschter Insektenpanzer.“ Charles
Baudelaire bescheinigte gar jeder Maschine „heilig wie ein Kunstwerk“
zu sein. Doch gleich hinter der Kontemplation kommt radikale Biopraxis. Neben der Naturästhetik um ihrer selbst willen
bis hin zu postkartenreifen Ergüssen, die die Malediven für die Welt
halten, erleben wir heute die Lust am Widerstand, an grünem Klassenkampf
und Abenteurertum. 40.000 Castor-Gegner mit Plakaten, Lampions,
Fan-Artikeln aller Sorten, das ist politische Lagerromantik mit hartem
Kern. Gorleben, Wendland, Anti-Castor heißt Camp und Abenteuer,
Organisation und Idealismus, Selbstiszenierung und politische Wahrheit.
Aktuell Polizeiknüppel kassieren oder später an Leukämie sterben, so
lautet die Alternative für die Akteure, die hochmoralisch wie immer für
die Rettung der Menschheit optieren. Zur unabdingbaren Freiheitspraxis gehört
„High sein, frei sein, Terror muss dabei sein“. Abbeys Helden sind gefährliche
„Idealisten“, weil Unternehmer und Geschäftemacher mit diesem Typus
nicht gerechnet haben und ihn (bis heute) nicht verstehen können. Ökoaktivismus
ist im Blick auf die „Kriegsziele“ ein asymmetrischer Kampf.
„Kriminelle“, denen es nicht um die Kohle geht, sondern um den Canyon
und die berührte Natur, passen weder in das biblische System der
gottgewollten Ausbeutung einer Erde, die „untertan“ zu sein hat noch
in das System der Strafjustiz, die schon immer mit ehrenhaften Gesinnungen
größte Probleme hatte. Liebe zur Natur und Widerstand gegen die
Zivilisation reiben sich an unserer bequemen Alltagsdialektik von
schneidiger Naturausbeutung und folgenloser Freizeitnatur. Für Henry
David Thoreau und noch wirkungsmächtiger für den Paten des Natürlichen,
Jean-Jacques Rousseau, ist das Grundverhältnis Mensch, Technik und Natur
dramatisch bis antagonistisch ausgelegt. Wer Technik will, verliert sein
unverbildetes Selbst und hat ein gestörtes Verhältnis zur Natur. Der Weg
von der Pervertierung des natürlichen Menschen zur Rückgewinnung der
Erde, zum unverbrüchlichen Fundament wahren Menschseins wird umso
schwieriger je unübersichtlicher die Zeitläufte werden.
„Holding
out for a hero“
(Bonnie Tyler) Umweltaktivisten sind Helden in einer Zeit, die
das Heldentum längst entsorgt hat. Aus Achill wurde Brad Pitt, was an
sich nicht schlecht ist, aber einen unhintergehbaren Mythenwandel anzeigt,
vom heroischen Mythos zum cineastisch inszenierten, der beliebig
reproduziert, aber nicht mehr erzählt werden kann. Ex-Außenminister sind
Ex-Streetfighter, was zwar den Begriff der bürgerlichen Karriere
erstaunlich dynamisiert, doch nie in die Nähe des Göttlichen kommt. Und
das neue profane Heldentum, das Edward Abbey besingt, ist zudem eine höchst
skrupulöse Angelegenheit: Seine Helden vernichten einen riesigen
Caterpillar „Hyster“ mit Lust an der Zerstörung. Aber was ist
geschehen? „Mord an einer Maschine. Gottesmord.“ Übersetzt heißt
das: Wenn die Evolution doch diese Stahlungeheuer will, wie kann man dann
dagegen sein? Bonnie will noch die Sitze aufschlitzen. Halt! Das ist
bereits „Vandalismus“. Wir begreifen langsam die Idiosynkrasien der Öko-Moral,
die Abbey über den vulgären Gegensatz von göttlicher unberührter Schöpfung
und Menschenwerk hinausgelangen lässt. Oder wie steht es mit der Moral
der Bierdosenwerfer? Einer sagt, dass er gegen die Naturfrevler kämpft,
die Bierdosen in Gottes schöne Landschaft werfen. Hayduke bekennt prompt,
dass er genau das tue. Aus politischer Überzeugung. Wir vermüllen die
Landschaft, um es den Geschäftemachern und Ausbeutern aller Sorten zu
zeigen. Jean Starobinski hat dieses Prinzip ökoterroristisch eingesetzter
Bierdosen avant la lettre bei Jean-Jacques Rousseau entdeckt und
hegelianisch als „Negation der Negation“ eingeführt. Zurück zur
Natur heißt deren Negation durch die Gesellschaft und deren hohle
Verstellungen in einer unwahren zweiten Natur zu negieren. Der Angriff
gilt gerade diesen zivilen Ordnungsstrukturen, die sich paranatürlich vor
die Natur geschoben haben. Mit anderen Worten: der glatte Asphalt durchs
Terrain, die schmucken Mülleimer am Straßenrand, die niedlichen
Toilettenarchitekturen für Touris – alles das muss weg! Diese
Bierdosendialektik verrät uns – wir haben es schon geahnt – , dass es
weiterhin kein wahres Leben im falschen gibt. Ambivalenz ist unser natürliches
Grundgesetz, der edle Wilde ist ein lächerliche Fiktion. Die letzten
Mohikaner verkommen bei Abbey zu zweifelhaften Peripheriewesen. Das Heldentum wird in der ökologischen Erlösung
der Welt vom Übel permanent beschworen, weil es für den einzelnen
Protagonisten einen plausiblen Persönlichkeitsentwurf anbietet, damit die
Outdoor-Lust einen konkreteren Anlass findet als wohliges Wallen über
Waldwege in wilder Watzlandschaft. Robin Wood – pointierter kann man das
alte mit dem neuen Paradigma nicht kurzschließen. Nicht mehr heldischer
Kampf im Wald für die Armen, sondern heldischer Kampf für den Wald und
gegen den Feinstaub. Piratenromantik: „Klar zum Entern! - Klimaschutz
selber machen“. Die grüne Semantik lässt keine Fragen offen: von „Rainbow
Warrior“ und „Grünhelmen“ bis hin zur radikalen „Earth Liberation
Front“ erweitert die ökologische Mobilisierung die Kampfzone genauso
wie der ewige Widersacher, das marodierende Geld, mit dem für alle
verbindlichen Motto: think global, act local. Globaler Kampf für den
Globus – die ökologisch unhintergehbare Tautologie. „Wir rekrutieren
junge Muslime und junge Christen und alle Menschen guten Willens für
diese Bauteams, die eines klar wissen: Die Schöpfung darf von uns nicht
einfach zerstört werden.“ Diese Friedensrekrutierung der Grünhelme
kaschiert das Problem, weil die Welt nicht so einfach gestrickt ist, dass
der Gutmenschen-Voluntarismus, der alle bestehenden Differenzen ignorieren
möchte, bereits die Lösung wäre. Verkoppelt sich das mit
Sendungsbewusstsein, wird die Packung vollends brisant. Der Biosoph Ernst
Fuhrmann machte es uns auf Schopenhauers Holzweg vor: „Im Grunde aber können
nur Menschen Geschichte machen, die ganz im Sinne des biologischen Willens
der Natur stehen…“ Das ist für Adepten ein gefährlicher Glaube,
keinen Steinwurf von der Unbedingtheitsethik von Gotteskriegern entfernt. Es
geht um Befreiung und die alten Ludditen sind nicht weit. Ned Ludd galt
als verrückt, aber er konnte den Feind klar erkennen, heißt es bei
Abbey. Nun mag das bei 12.000 eingesetzten britischen Soldaten vorderhand
nicht schwer gewesen sein. Heute ist das anders. Denn der Feind ist dieses
metastasenhafte System mit zahllosen Ein- und Ausschlussfunktionen, ja
mehr: die Freund-Feind-Kennung, von der Carl Schmitt träumte, hat sich
nicht nur im Politischen aufgelöst. Freund-Feind-Verwischungen werden
daher oft mit Wut gegen die Zumutungen besserer Erkenntnis nachkonturiert.
Aus der Beobachterperspektive verfugen sich die emotionalen Intensitäten
auf beiden Seiten zu einer schrillen Psychopathologie des Kampfes, indem
sich beide Seiten wechselseitig als Kriminelle bezeichnen. Die Polizei stöhnt:
„Diese Intensität der Straftaten haben wir 2008 nicht gehabt.“
(FAZ-Zitat 07. November 2010) Ziviler Ungehorsam heißt nun: „Castor?
Schottern!“ Schottern bedeutet, Schottersteine aus dem Gleisbett zu
entfernen. Die Monkey Wrench Gang geht gegen die Technik des Bösen
ungleich härter vor, aber die Publicity der modernen Ökoschotterer
reicht dafür über ein paar Sprayattacken mit wildromantischen Namenszügen
hinaus. Und die Fünf Finger-Strategie des Durchlaufens von
Frontstellungen der Polizei rechnet auch nicht zwingend mit Knast, mit dem
Maschinensturm schon je geahndet wurde. „Charlotte Roche und Bela B. sind
ab jetzt auch dabei“, freuen sich die Schotterer, die nicht nur den
Schienen das Fundament entziehen wollen. „Charlotte: "Ich habe den
Aufruf unterschrieben. Ich bin gegen Gewalt gegen Polizisten aber absolut
für Sachbeschädigung im Dienste der guten Sache." Alternativ bietet
sie noch mehr Öko-Aktivitäten an: Sex mit dem Bundespräsidenten
Christian Wulff, damit der ob so viel aufgedrängter Lust den Atomvertrag
nicht unterzeichne. „Ökologie“
ist auch jenseits der ideologischen Feucht- und Seichtgebiete eine
widersprüchliche Sache: Plädieren wir für Öko, retten wir die
Welt, vernichten aber vielleicht Arbeitsplätze. Umweltschutz heißt nach
alter Lesart, Kapitalisten zu bekämpfen und Prosperität zu vernichten.
Das ist längst komplexer geworden. Heißt jetzt „Öko“ Arbeitsplätze
zu schaffen und böse Ausbeutergewinne abzuschöpfen? Aber wie wollt ihr
sie dann noch – grün gesprochen – an ihren Früchten erkennen? Der
schillernde Terminus „Grüner Kapitalismus“ steht für die
Absorptionskraft eines Prinzips, das jede Ethik, jede Ideologie
verarbeitet, wenn es der Fruchtbarwerdung des Geldes dient. Edward Abbey hätte
von diesen windigen Dialektiken nichts gehalten, weil das karzinogene
Geldverhältnis per se pervers sei: „Wachstum um des Wachstums willen
ist die Ideologie der Krebszelle.“ Widerstand heißt, man muss die
Maschinerie gut begreifen, ohne dass der Begriff widernatürlicher Technik
auch nur ansatzweise helfen würde, dieses Phänomen zu deuten.
Bis zur
nächsten Apokalypse Die Liebe zur Natur geriert sich als
Religionsersatz und ist oft nicht weniger fundamentalistisch als jene. Der
norwegische Philosoph Arne Næss definiert
seine „Tiefenökologie“ (!) so: …ich könnte sie auch „Grün“
nennen – die Grüne Bewegung ist eine Bewegung in der man nicht nur
Gutes für den Planeten im Interesse der Menschen tut, sondern auch im
Interesse des Planeten selbst. Das heißt, man betrachtet den Globus als
Einheit und spricht über die einzelnen Ökosysteme, man versucht, sie am
Leben zu erhalten als ein Wert für sich.“ Tiefenökologische Ansätze
sind säkularisierte Versionen des alten Schöpfungsglaubens, des
Vertrauens in die gute Einrichtung der natürlichen Welt. Ein endloses
Kapitel bleibt darin die unauflösliche Spannung zwischen der vorgeblich
unschuldigen äußeren Natur und der inneren unbefriedeten Menschennatur,
die Immanuel Kant fast euphemistisch und für einen Pflichtenethiker
bemerkenswert exkulpatorisch auf den Punkt brachte: „Aus so krummem
Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades
gezimmert werden.“ Das hören Naturholisten und Apostel des
Authentischen freilich nicht gern. Jean-Jacques Rousseau war der in sich
zerrissene Prophet, der zugleich den Revolutionären von 1789 das
philosophische Rüstzeug für widernatürliche Eingriffe an die Hand bzw.
Guillotine gab. Henry David Thoreau war für die puristisch
nordamerikanische Ökovariante der Zivilisationsflucht zuständig, wobei
sein Widerstand gegen die Unsinnigkeiten seiner Zeit eben zum
Fundamentalismus neigte, weil ihm die Dialektik fehlte zu begreifen, dass
Zivilisationen angesichts ihrer unheimlichen Technik wachsen und reifen. Für
den Meister der Holz- und Feldwege aus Deutschland, Martin Heidegger, lag
dagegen gerade in der immer mächtigeren Technik die eigentliche
Herausforderung des Seins. Das Exil in den Wäldern - mit oder ohne
survival kit - ist dagegen eine romantisch-eskapistische Version der
Zivilisationsmüdigkeit. Die Natur als Schrecken, als Chaosfeld der Viren
und Bakterien, der fragilen Sollbruchstellen und perennierenden
Katastrophen, wie sie bisher keine Technik beherrscht, das alles soll
nicht existieren. Wer die Monkey Wrench Gang in ihrem Tun verfolgt, kann nicht überlesen, dass das Buch nach seinem großartigen Auftakt Längen hat, so wie sie Feld- Wald und Wiesenwege nun einmal haben. Die zahllosen Destruktionsschritte nutzen sich über ein paar hundert Seiten auch ab. Einige technische Details zum allfälligen Zerstörungswerk hätte sich Edward Abbey im Sinne seines literarischen Unternehmens durchaus schenken sollen. Er peinigt uns nicht so schlimm exkursiv wie Hermann Melville, der einen nolens volens zum Walwissenschaftler macht, während man doch nur über einige apokalyptische Finsterwellen reiten wollte. Der vormalige Ranger Abbey schickt den Leser immer wieder in den Wald, auch zum Studium der lateinischen Namen der Botanik. Das liegt in der Familie. Rousseau erging sich in der Betrachtung von Pflanzen, als ob sie ihm – wie Jean Starobinski bemerkt – die vegetabilische Unschuld zurückgeben könnten. Giftige Pflanzen mied er. Diese böse, widerwärtige Natur ist für erdgebundene Sozialromantiker kein Gegenstand ihres Engagements. Abbeys kämpferische Ökotopie wird inzwischen
von Formen des Öko-Widerstands angereichert, der gelernt hat, dass
Maschinen zu zerstören nur eine punktuelle Geste ist, ein symbolischer
Akt in einer Welt, die endlos reproduziert, was so oder so zerstört wird.
„Macht kaputt, was euch kaputt macht.“ Selbst den frühen Adepten
solcher Mottos war klar, dass das nicht bereits die Lösung ist. Es gibt
eine bedingt erhellende Historiker-Diskussion über die Frage, wen oder
was die Maschinenstürmer treffen wollten. So viel steht inzwischen fest:
Sie hassten, von Ausnahmen abgesehen, nicht Maschinen aus einem
technophoben Ressentiment heraus, sondern wollten ihre Arbeitsplätze und
Lebensbedingungen sichern. Es handelte sich in den Worten von Eric
Hobsbawm um den nicht immer erfolglosen Kampf am Rande des „starvation
level“. Heute geht es auch um weniger dramatische Kampf- und
Partizipationsformen, die den Widerstand in seinen vielfältigen Formen
entwickeln, die sich einnisten und rhizomatisch, also in subversiver
Pflanzentechnik, im und über den öffentlichen Raum verteilen. Goedart Palm Edward
Abbey Die Monkey
Wrench Gang Neuedition
Walde+Graf 2010
ISBN 978-3-03774-015-6 Dave
Foreman, Ecodefense – A Field Guide to Monkeywrenching, Abbzug Press (!)
1993 Ernst
Fuhrmann, Was die Erde will. Eine Biosophie, München 1986 Martin
Henkel/Rolf Taubert, Maschinenstürmer, Ein Kapitel aus der
Sozialgeschichte des technischen Fortschritts, Frankfurt 1979 Richard
Kahn, From Herbert Marcuse to the Earth Liberation Front: Considerations
for Revolutionary Ecopedagogy, unter: http://richardkahn.org/writings/ecopedagogy/frommarcusetoelf2.pdf Jean
Starobinski, Rousseau, München 1988.
|
|
ö
|
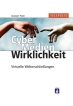




 Die
1979 im Südwesten der USA gegründete Bewegung „Earth First!“ wurde
unmittelbar von Edward Abbeys fröhlicher Bibel des Ökoaktivismus
inspiriert. Im Logo von Earth First! kreuzen sich heute noch Abbeys
Universalschraubenschlüssel und ein selbst fabriziertes Steinzeitbeil.
Earth First! und Monkey Wrench Gang spielen dieselben Spiele: Baumaschinen
werden mit Sand gefüttert, Vermessungsmarkierungen werden verlegt oder
entfernt, Masten umgestürzt und Kabel aller Sorten (Nervensysteme der
Technik) durchtrennt. Im Grunde zeichnet „The Monkey Wrench Gang“ auch
das Schisma bei Earth First! vor, als sich 1992 die gewaltbereitere
„Earth Liberation Front“ konstituiert. Während Doc Sarvis die
„kleinen gelben Blumen“ vermisst, geht ihm der parodisierende, doch
durchaus ernst gemeinte Slogan durch den Kopf: „Unterstützen auch Sie
Ihre örtliche Öko-Terror-Gruppe“. Was nun Öko-Terrorismus von „ecodefense“
unterscheidet, ist selbst Teil des Kampfes. Die Earth Liberation Front
avancierte in der Wahrnehmung des FBI zur erstrangigen Terrorgruppe, während
deren immergrüne Rechtfertigung lautete, dass Menschen nicht zu Schaden
kommen. Das ist auch für Abbey die Demarkationslinie. Sprengstoff hat
allerdings „überschießende Tendenzen“, was schnell jedes ökopazifistische
Selbstverständnis in den Sog der Ereignisse ziehen kann. In dem
automatischen Zug, den die Gang hochgehen lässt, saß doch ein
menschlicher Kontrolleur. Damned! „Collateral damage“ wäre eine
armselige Erklärung auch und gerade für Ökokrieger, die ohne spin
doctors und Lügenmoral demokratischer Kriegsherren mit ihrem eigenen
Gewissen auskommen müssen. In Abbeys moralischem Lehrstück schafft es
der letzte Mensch der Automatenwelt dann noch knapp, mit dem Leben
davonzukommen. Für die literarische Dramatik ist das ein
Spannungsverlust. So wird der Sprengstoffprofi Hayduke schließlich in
Fetzen gerissen. Das hat er nun davon, wenn er ständig mit soviel
Sprengstoff herumspielt. Halt! Es war doch nur ein
literarisch-dramatischer Stunt, der seine Wiederauferstehung zulässt, die
ihn wieder mit den Gefährten zusammenführt. Doc, der Kampf geht weiter!
- bis zum nächsten Ende der Welt.
Die
1979 im Südwesten der USA gegründete Bewegung „Earth First!“ wurde
unmittelbar von Edward Abbeys fröhlicher Bibel des Ökoaktivismus
inspiriert. Im Logo von Earth First! kreuzen sich heute noch Abbeys
Universalschraubenschlüssel und ein selbst fabriziertes Steinzeitbeil.
Earth First! und Monkey Wrench Gang spielen dieselben Spiele: Baumaschinen
werden mit Sand gefüttert, Vermessungsmarkierungen werden verlegt oder
entfernt, Masten umgestürzt und Kabel aller Sorten (Nervensysteme der
Technik) durchtrennt. Im Grunde zeichnet „The Monkey Wrench Gang“ auch
das Schisma bei Earth First! vor, als sich 1992 die gewaltbereitere
„Earth Liberation Front“ konstituiert. Während Doc Sarvis die
„kleinen gelben Blumen“ vermisst, geht ihm der parodisierende, doch
durchaus ernst gemeinte Slogan durch den Kopf: „Unterstützen auch Sie
Ihre örtliche Öko-Terror-Gruppe“. Was nun Öko-Terrorismus von „ecodefense“
unterscheidet, ist selbst Teil des Kampfes. Die Earth Liberation Front
avancierte in der Wahrnehmung des FBI zur erstrangigen Terrorgruppe, während
deren immergrüne Rechtfertigung lautete, dass Menschen nicht zu Schaden
kommen. Das ist auch für Abbey die Demarkationslinie. Sprengstoff hat
allerdings „überschießende Tendenzen“, was schnell jedes ökopazifistische
Selbstverständnis in den Sog der Ereignisse ziehen kann. In dem
automatischen Zug, den die Gang hochgehen lässt, saß doch ein
menschlicher Kontrolleur. Damned! „Collateral damage“ wäre eine
armselige Erklärung auch und gerade für Ökokrieger, die ohne spin
doctors und Lügenmoral demokratischer Kriegsherren mit ihrem eigenen
Gewissen auskommen müssen. In Abbeys moralischem Lehrstück schafft es
der letzte Mensch der Automatenwelt dann noch knapp, mit dem Leben
davonzukommen. Für die literarische Dramatik ist das ein
Spannungsverlust. So wird der Sprengstoffprofi Hayduke schließlich in
Fetzen gerissen. Das hat er nun davon, wenn er ständig mit soviel
Sprengstoff herumspielt. Halt! Es war doch nur ein
literarisch-dramatischer Stunt, der seine Wiederauferstehung zulässt, die
ihn wieder mit den Gefährten zusammenführt. Doc, der Kampf geht weiter!
- bis zum nächsten Ende der Welt. 